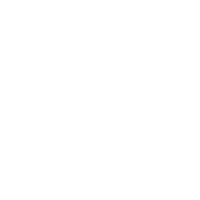
Die Unmöglichkeit, keine Freunde zu haben
Als „mija“ in Ecuador
Mit 16 Jahren bot sich mir die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, in eine andere Kultur eintauchen, Menschen aus der ganzen Welt kennen lernen und ein Abenteuer erleben - die Welt entdecken. Ich wohnte in einem furchtbar kleinen Ort, und auch wenn ich froh bin, hier aufgewachsen zu sein, wollte ich mehr von der Welt sehen, ich wollte wissen, was es sonst noch für mich zu entdecken und sehen gibt. Ich wollte meinen Horizont erweitern.
Ich hatte die Qual der Wahl: das gute alte Europa, ganz klassisch USA, das temperamentvolle Lateinamerika, das bunte Afrika oder ins exotische Asien? Ich entschied mich für Costa Rica, für ein Land auf der anderen Erdballhälfte und schlussendlich wurde es Ecuador: das Land in der Mitte der Welt, voller Gegensätze. Das Land, in dem es alle Vegetationszonen gibt, in dem man vom Meer bis zum höchsten Gipfel der Welt (vom Erdmittelpunkt aus gemessen) alles vorfindet. Ein Land in dem man in eine ganz andere Welt eintaucht, immer wieder etwas Neues entdeckt.
Nach meiner Ankunft wurde mir klar, dass ich in einem Land der Extreme gelandet war, und meine Aufnahmefähigkeit durch seine Vielfalt sehr strapazierte. Als wir am ersten Tag durch die Straßen fuhren, fiel mir zuerst das Chaos, der Lärm, der Schmutz und die Unordnung auf. Alles war anders als in Österreich. Obwohl mir im Laufe des Tages heiß wurde, merkte ich, dass die Menschen hier in Pulli und Jeans herum liefen – ich wusste noch nicht, dass in Quito das Wetter in Minutenschnelle umschlagen kann. Auch kam es mir komisch vor, dass die Sonne immer gleich unterging. Meiner Meinung nach viel zu bald, aber in einem Land am Äquator ist das nun mal so. Als ich das erste Mal Santo Domingo sah, kam es mir noch mal lauter und schmutziger vor. Ich brauchte ein paar Monate, um die Stadt lieb zu gewinnen.
Der aller schönste Moment war, als ich mich zum ersten Mal zu Hause fühlte, als ich fühlte, dass ich „angekommen“ bin. Ich wurde mit einem Bussi auf die Wange begrüßt und in der Schule gegrüßt. Ich konnte den Alltag meistern und musste darüber gar nicht mehr nachdenken oder mich anstrengen. Dieses Gefühl, eine zweite Heimat zu haben und durch die Stadt zu gehen, als würde man schon ein Leben lang hier wohnen, ist das Allerschönste. (Fast) alles wird zu einem einzigen schönen Moment.
Freundschaften zu schließen fällt einem generell, soweit ich das sehe, in den meisten lateinamerikanischen Ländern leicht, da die Latinos eine unglaublich herzliche Art haben, auf Fremde zuzugehen und zudem großes Interesse für „Gringos“ haben. Anfangs kamen mir die Freundschaften teils etwas oberflächlich vor, da sofort jeder ein „amigo“ ist, aber nach ein, zwei Monaten hatten sich einige richtige und wertvolle Freundschaften entwickelt. Zu meinen ecuadorianischen Freunden kann ich nicht nur meine Schulkolleginnen und -kollegen zählen, sondern auch Nachbarn, Lehrer und so weiter. Es ist eigentlich nicht möglich, in Ecuador keine Freunde zu haben.
Ich kann mich noch gut an meinen ersten Schultag in der katholischen Privatschule – das ist durchaus üblich für Lateinamerika - „Colegio Maristas PIO XII“ erinnern und an die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen: Wie werden sie mich begrüßen? Was, wenn sie mich ignorieren? Oder nicht verstehen? Obwohl ich den Großteil nicht verstand, wurde ich nichtsdestotrotz allen möglichen Leuten vorgestellt und gleich zu Fiestas eingeladen. Meine größte Angst, dass ich allein bleiben würde, war vollkommen unberechtigt. Die Schule war sehr interessant. Obwohl die Schwerpunkte der Schule ganz andere waren als in Österreich fand ich es aufregend, diesen Schulalltag kennen zu lernen. Manche Dinge erschienen mir eigenartig, wie die Versammlung, das Beten jeden Morgen, aber mit der Zeit lernte ich, diesen Traditionen auch Positives abzugewinnen und vor allem gefiel mir, wie viel Interesse uns Austauschschülern von Seiten der Schüler und Lehrer entgegengebracht wurde.
Vor meinem Austauschjahr hatte ich ein Jahr Spanisch in der Schule. Doch als ich in meiner Gastfamilie ankam, verstand ich trotzdem nur Wortfetzen. Zum Glück sprachen mein Gastvater und meine Gastschwestern etwas Englisch, allerdings mit meiner Gastmutter konnte ich mich anfangs kaum unterhalten. Doch schon nach ein paar Tagen beschlossen sie: „Solo Español!“ und damit taten sie mir einen großen Gefallen. Auch wenn ich weder in der Familie noch in der Schule, wo ich auf Spanisch bestand, kaum etwas mitbekam, wurde es mit jeder Woche besser. Einmal kehrte mein Gastpapa von einer mehrtägigen Geschäftsreise heim und sagte mir, dass mein Spanisch schon deutlich besser geworden sei. Ich strahlte von einem Ohr zum anderen. In zwei Monaten schaffte ich es, mich verständlich zu machen und auch bei Gesprächen mitzukommen. Das einzige, das ich bis zum Ende meines Austauschjahres nie los wurde, war meine einzigartige Aussprache. Obwohl alle eifrig Sprechübungen mit mir absolvierten, schaffte ich es nicht, diese abzulegen. Doch immerhin sorgte das für einige Lacher, als wir statt eines „Birnenauflaufs“ plötzlich „Hundeauflauf“ aßen.
Von Anfang an war ich von der Herzlichkeit der Latinos überrascht. Diese nimmt lustigerweise zu, je näher man der Küste kommt. Während die Serranos, die Leute in den Anden durchaus auch freundlich sind, kennt die Freundlichkeit der Costeños kaum Grenzen. Jedoch wird man im ganzen Land sofort als „mija“ meine Tochter bezeichnet, seien es die tatsächlichen Eltern, Freunde, Lehrer oder einfach der Kassierer im Supermarkt. Außergewöhnlich ist, dass man beim Fortgehen einfach mal anfängt in der Straße zu tanzen, wenn gerade keine Fiesta ist. Kulinarisch vermisse ich die Kochbanane (man kann sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich sie hier in Österreich fand), die Meeresfrüchte, Encebollado (herrlich nach einer durchfeierten Nacht), Tamales und Humitas (Maisgerichte eingewickelt in Blätter) und die unzähligen Früchte.
Weitere Unterschiede zu Österreich erlebte ich, als ich dann draufkam, dass irgendwie niemand einen Briefkasten besitzt. Ich stellte fest, dass das in Ecuador über eine Postzentrale geregelt wird, wo man die Briefe nicht nur aufgeben, sondern auch abholen muss. Das kann ein sehr langwieriger und nervenaufreibender Prozess sein, der einen ziemlich zur Weißglut treibt und einen merken lässt, dass in Ecuador die Dinge generell ohne Hast ablaufen und das auf Pünktlichkeit wenig bis gar kein Wert gelegt wird. Durch diese Gemütlichkeit, die man sich dann auch mal aneignet, stört es dann auch nicht mehr, dass Busse irgendwann kommen- oder auch nicht. Das Positive dabei ist, dass man diesen einfach heranwinken kann und nicht zur nächsten Haltestelle gehen muss. Anders als hier in Österreich ist auch das Familienleben, denn der Vater ist das Oberhaupt und trifft somit auch stets die Entscheidungen. Das kann zwar vor allem anfangs einengend sein, aber schließlich auch Geborgenheit und Sicherheit geben und das Gefühl von Zugehörigkeit. Das sind nur ein paar wenige von vielen Unterschieden, die teils sehr anstrengend, unverständlich und gewöhnungsbedürftig aber auch sehr spannend und lehrreich sein können, und erst danach sind mir viele Eigenheit der österreichischen Kultur aufgefallen.
Obwohl das Austauschjahr eine große Herausforderung mit vielen Höhen und Tiefen war habe ich meine Entscheidung jedenfalls nicht ein einziges Mal bereut...